Asset Management
Betreiberverantwortung: Was genau ist das und wo ist sie geregelt?
Wenn es um das Haftungsrisiko von Immobilien geht, fällt schnell das Wort „Betreiberverantwortung“. Wo ist diese Verpflichtung definiert, wen betrifft sie und was ist konkret zu tun?
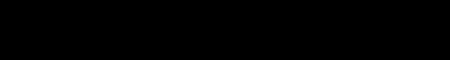
Mit solchen Fragen beschäftige ich mich als Asset Manager seit Jahren. Aus Fachpublikationen und Gesprächen mit Kollegen habe ich folgenden Überblick zusammengestellt. In diesem Beitrag geht es vor allem um Gebäude mit umfangreichen technischen Anlagen und hohen Brandschutzanforderungen wie z. B. neuere Bürogebäude, Hotels, Sozialimmobilien und andere Sonderbauten.
Rechtliche Grundlagen
In keinem Gesetz findet man die Begriffe „Betreiberverantwortung“ oder die verwandte „Verkehrssicherungspflicht“. Sie erscheinen nur in der Rechtsprechung. Dabei stützen sich die Gerichte vor allem auf die allgemeine Schadensersatzpflicht nach § 823 BGB und auf die Haftung des Grundstücksbesitzers nach § 836 BGB. Ausserdem steht in jeder Bauordnung sinngemäß der folgende Satz: „Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden“ (in § 3 der Bauordnung NRW 2018).
Um die Gefahren für Leben, Gesundheit, Natur und Eigentum, die von Gebäuden ausgehen können, beherrschbar zu machen, ist ein verantwortungsvoller Gebäudebetrieb erforderlich. Zu diesem Zweck besteht eine Vielzahl von Regelungen aus unterschiedlichen Quellen:
- Gesetze und Verordnungen des Bundes und der Bundesländer: Neben dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Strafgesetzbuch (StGB) sind dies z. B. das Gebäudeenergiegesetz (GEG), die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Prüfverordnung NRW (PrüfVO NRW), die Bauordnung NRW und die Sonderbauverordnung NRW (SBauVO NRW);
- Technische Regeln von staatlichen Ausschüssen, z. B. die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) und die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS);
- Unfallverhütungsvorschriften der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung): zentral sind hier die Vorschriften zur regelmäßigen Prüfung elektrischer Anlagen, DGUV Vorschrift 3 bzw. 4 (früher bekannt als „BGV A3-Prüfung“);
- Normen und Richtlinien von privaten Verbänden und Vereinen: Dies umfasst die berühmte DIN (Deutsche Industrie Norm), die fast alles regelt, was mit Planen und Bauen zu tun hat. Ausserdem die Richtlinien des VDI (Verband der Deutschen Ingenieure) z. B. die VDI 6023 für Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasserinstallationen und die VDI 3810 für das Betreiben von gebäudetechnischen Anlagen; des VDE (Verband der Deutschen Elektrotechnik) z. B. die VDE DIN 0105 Teil 100 für das Betreiben von elektrotechnischen Anlagen; des VdS (Verband der Deutschen Sachversicherer) z. B. die VdS CEA 4001 als Standard für Planung, Bau und Betrieb von Sprinkleranlagen und des DVGW (Deutscher Verband des Gas- und Wasserfachs), der Arbeitsblätter zu Gas- und Trinkwasserinstallationen veröffentlicht. Immer mehr Anerkennung finden auch die Richtlinien und Empfehlungen der Verbände der Betreiber und Facility Manager, AMEV und GEFMA.
Die Gesetze, Verordnungen, Technischen Regeln und Richtlinien privater Verbände bilden eine zusammenhängende Regelungskulisse. Wobei der Gesetzgeber die übergeordneten Ziele formuliert und die technischen Details den unterschiedlichen Fachausschüssen und Verbänden überlässt. Denn diese können neue technische und wissenschaftliche Erkenntnisse viel schneller erfassen und einarbeiten. Mit sogenannten „Technikklauseln“ wird in Gesetzestexten auf die privaten Regelungsquellen verwiesen. Davon die wohl bekannteste ist der Verweis auf die „allgemein anerkannten Regeln der Technik“.
Was einen einfachen Überblick erschwert ist, dass die verpflichtete Person in diesen Quellen unterschiedlich bezeichnet wird: Die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) spricht von „Arbeitgeber“, die Technische Regel Arbeitsstätten (ASR) nennt ihn „Unternehmer“ und seit Juni 2023 steht in der Trinkwasserverordnung endlich der „Betreiber“ und nicht mehr der „Unternehmer oder sonstiger Inhaber“ abgekürzt als „Usl“. Alle diese Bezeichnungen beziehen sich auf die Person, die letztendlich verantwortlich ist, den Betreiber.
Unter die Betreiberverantwortung fällt auch ein Teil der Pflichten aus dem Arbeitsschutz. Dies betrifft zum Beispiel sämtliche Aufzüge. Diese gelten gemäß BetrSichV als Arbeitsmittel und sind in bestimmten Fristen zu prüfen. Praktisch liegt diese Pflicht beim Vermieter, möglicherweise auch beim alleinigen Mieter oder Nutzer einer Immobilie.
Betreiberhaftung
Falls es bei einem Unfall zu einem schweren Personenschaden kommen sollte, wird sich die Staatsanwaltschaft einschalten. Dann muss der Betreiber nachweisen, dass er seiner Betreiberverantwortung nachgekommen ist. Dafür ist eine möglichst vollständige Dokumentation die beste Grundlage.
Rolle des Betreibers
Betreiber ist in erster Linie der Eigentümer einer Immobilie. Dieser kann eine natürliche oder juristische Person sein. Wenn eine Immobilie nur einen einzigen Mieter oder Nutzer hat, werden diesem häufig umfangreiche Pflichten übertragen. Dies sollte im Mietvertrag bzw. in der Nutzungsvereinbarung ausdrücklich und ausführlich vereinbart werden. Es ist auch möglich, Betreiberpflichten auf einen externen Dienstleister, z. B. einen Asset Manager, zu übertragen. Auch dies sollte ausführlich vertraglich geregelt werden. Man findet diesen Fall häufig, wenn der Eigentümer im Ausland ansässig ist und mit den nationalen Regeln und Gesetzen nicht vertraut ist. Auch wenn der Eigentümer bestimmte Betreiberpflichten an Dritte delegiert, muss er diese in geeigneter Weise überwachen. Eine vollständige Befreiung von der Betreiberverantwortung durch Delegation an Dritte ist nicht möglich. Dazu hat die Rechtsprechung den Tatbestand des Organisationsverschuldens entwickelt. Danach muss ein Inhaber von Betreiberpflichten eine geeignete Organisation schaffen, die sicher stellt, dass die Betreiberpflichten vollständig berücksichtigt und auch tatsächlich erfüllt werden.
Wer im Einzelfall als Betreiber gilt, ergibt sich aus den konkreten Eigentumsverhältnissen, Mietverträgen, Nutzungsvereinbarungen und Verträgen mit externen Dienstleistern.
Die Richtlinie GEFMA 190 definiert den Betreiber nach dem bestimmenden Einfluss auf den Betrieb der Immobilie unter Berücksichtigung rechtlicher, wirtschaftlicher und tatsächlicher Umstände. Als beauftragter Betreiber benötigt man also neben einem klaren Auftrag auch die erforderlichen Mittel, Fachkenntnisse und Weisungsbefugnisse bzw. eigenes Personal.
Praktische Umsetzung
Das folgende praktische Vorgehen zur Wahrnehmung der Betreiberverantwortung hat sich nach meiner Erfahrung als Asset Manager bewährt:
- Bestandserfassung: Erfassung aller vorhandenen Bauteile und technischen Anlagen, an die Anforderungen gestellt werden. Parallel dazu werden alle erteilten Baugenehmigungen, Nutzungsgenehmigungen, Brandschutzkonzepte, Fachunternehmererklärungen und Verwendbarkeitsnachweise erfasst.
- Regelkataster: Erfassung aller bestehenden Regeln und Vorschriften zu den einzelnen Bauteilen und technischen Anlagen.
- Planung der Wartungen, Inspektionen und Prüfungen. In der Regel werden dazu Verträge mit externen Wartungsfirmen und Prüfern geschlossen. Möglicherweise werden einige Wartungen und Inspektionen intern durchgeführt. Die Kosten werden in einem mehrjährigen Budget geplant.
- Planung klarer Zuständigkeiten und Kommunikationsflüsse.
- Laufende Dokumentation sämtlicher Wartungen, Inspektionen, Prüfungen, Mangelbeseitigungen, Verbesserungen und sonstigen baulichen Anpassungen.
Bei Fragen zu diesen Themen, bei der Umsetzung einer geeigneten Organisation und bei der Beseitigung von Mängeln helfe ich gerne weiter. Ich bin kein Jurist und erteile keine Rechtsberatung.
Die Inhalte dieses Beitrags habe ich unter anderem aus folgenden Quellen recherchiert:
– Hans-Thomas Damm und Hartmut Hardt, Verkehrssicherungspflichten in der Immobilienwirtschaft, 5. Auflage (2021)
– Jörn Krimmling (Hrsg.), Altas Gebäudetechnik, 3. Auflage (2021)
– Stefan Plesser, Qualitätsmanagement in der Gebäudetechnik (2020)
– Mark Seibel, Baumängel und anerkannte Regeln der Technik (2009)
– Richtlinie GEFMA 190: Betreiberverantwortung 2.0 im Facility Management (2023)
– Richtlinie GEFMA 310: Vorschriften, Technikklauseln und Konformitätslevel im FM (2023)
– https://www.gesetze-im-internet.de
– https://www.dguv.de
– https://www.dvgw.de
– https://www.gefma.de
– https://www.amev-online.de