Neue Trinkwasserverordnung 2023
Seit Juni 2023 gilt die neue Trinkwasserverordnung. Für wen gilt sie und welche neuen Regelungen sind relevant? Ich habe mir den sperrigen Text angesehen und in der Praxis umgesetzt.
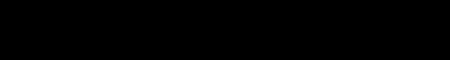
Im Vergleich zur vorherigen Fassung wurde die neue Trinkwasserverordnung von 25 auf 72 Paragraphen erweitert. Neu ist die Einführung eines risikobasierten Schutzkonzepts für die gesamte Versorgungskette von der Gewinnung des Trinkwassers über Speicherung, Verteilung bis zur Entnahme am Wasserhahn. Relevant für Betreiber von Gebäuden sind das neue Verbot von Blei ab Anfang 2026, die Verschärfung einiger Prüfparameter und – wie bisher – die Pflicht zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene.
Die aktuelle Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist am 24. Juni 2023 in Kraft getreten. Sie richtet sich nicht nur an Eigentümer und Betreiber von Immobilien, sondern auch an Gesundheitsämter, Laborbetriebe und Versorgungsunternehmen. Dies sind z. B. die Stadtwerke, die ganze Gebiete mit Trinkwasser versorgen. Jedoch reicht die Verantwortung dieser Versorger nur bis zum Übergabepunkt im Haus. Dies ist in der Regel der zentrale Wasserzähler. Ab hier beginnt die „Gebäudewasserversorgungsanlage“, für die der Betreiber des Gebäudes verantwortlich ist.
Als „Betreiber“ gilt entweder der Eigentümer oder ein Nutzer, der faktisch die Kontrolle über das Gebäude ausübt. Dies ist zum Beispiel ein Mieter, der ein Gebäude alleine (single tenant) und langfristig nutzt. Im Einzelfall kann sich dies aus dem Mietvertrag und den weiteren Umständen ergeben.
An die Versorger richten sich die neuen Vorgaben eines risikobasierten Schutzkonzepts und die Einführung neuer Prüfparameter zum Beispiel für PFAS (per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen). Diese auch als „Ewigkeits-Chemikalien“ bekannte Stoffgruppe ist gesundheitsschädlich und baut sich extrem langsam ab. Trotzdem wird sie in Outdoor-Bekleidung, Pfannenbeschichtungen und Kostmetika verwendet. Ausserdem wurden einige bestehende Prüfparameter verschärft (zum Beispiel für Chrom, Arsen und Blei).
Die Betreiber von Gebäuden betrifft das Verbot von Blei ab Januar 2026. Bleihaltige Teile von Trinkwasserinstallationen sind auszutauschen oder still zu legen. Installateure werden verpflichtet, das Gesundheitsamt zu informieren, wenn sie in einem Gebäude bleihaltige Leitungen feststellen und der Betreiber sie nicht mit der Demontage beauftragt.
Die Trinkwasserhygiene wird anhand von verschiedenen mikrobiologischen, chemischen und radiologischen Prüfparametern bestimmt. Wie schon bisher sind Betreiber von Gebäuden verpflichtet, diese einzuhalten. Unter anderem ist dazu eine professionelle Instandhaltung der Trinkwasserinstallation mit regelmäßigen Hygieneinspektionen erforderlich. Eine ausdrückliche Verpflichtung zu regelmäßigen Trinkwasseruntersuchungen bestimmt die Verordnung nur für gewerblich oder öffentlich genutzten Gebäuden und nur zur Prüfung auf Legionellen. Jedoch stehen alle Trinkwasseranlagen in öffentlich genutzten Gebäuden unter der Aufsicht der Gesundheitsämter. Diese legen nach § 55 TrinkwV den Untersuchungsumfang fest. Aus diesem Grund werden die Trinkwasserproben regelmäßig auf eine Bandbreite von Parametern untersucht.
Die vorgeschriebenen Fristen für Trinkwasseruntersuchungen sind mindestens alle 3 Jahre für gewerbliche Nutzungen und einmal jährlich für öffentliche Nutzungen. Allerdings können die Gesundheitsämter diese Fristen anpassen. Für privat genutzte Gebäude, die nur von den Eigentümern bewohnt werden, bestehen keine Fristen.
Als „öffentlich“ gelten Hotels, Restaurants, Museen, Schulen, Kitas, Krankenhäuser und Pflegeheime. Hier wird Trinkwasser an Personen abgegeben, mit denen kein Arbeits- oder Mietvertrag besteht. Mietwohnungen und Bürogebäude gelten als „gewerblich“. Falls in einem Mehrfamilienhaus mindestens eine Wohnung von Mietern bewohnt wird, gilt das gesamte Gebäude als „gewerblich“.
Den Text der Trinkwasserverordnung 2023 findet man unter https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/.
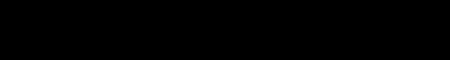
Welche Pflichten genau ergeben sich aus der Trinkwasserverordnung für Betreiber von Immobilien?
Zentral ist die Vorschrift zur regelmäßigen Untersuchung auf Legionellen nach § 31 TrinkwV in folgenden Fällen:
- Das Gebäude ist gewerblich oder öffentlich genutzt.
- Im Gebäude ist mindestens eine Dusche oder eine sonstige Anlage zur Vernebelung von Trinkwasser vorhanden.
- Es besteht eine zentrale Trinkwassererwärmung mit mehr als 400 Liter Inhalt oder einem Leitungsinhalt von mehr als 3 Liter, gemessen ab dem Ausgang des Trinkwasserspeichers bis zu einer Entnahmestelle.
Als Betreiber darf man kein Trinkwasser zur Verfügung stellen, das die vorgeschriebenen Prüfparameter nicht einhält (§ 49 TrinkwV). Alle Grenzwerte sind in den Anlagen der Verordnung aufgeführt und der Prüfungsumfang wird in der Regel durch das örtliche Gesundheitsamt festgelegt. Beispielsweise verlangt das Gesundheitsamt Köln nach meiner Erfahrung keine Untersuchung auf radiologische Parameter.
Ausserdem darf Trinkwasser nur in zulässiger Weise aufbereitet werden (§ 22 TrinkwV). Daraus folgt, dass der Betreiber die Aufbereitung des Trinkwassers, etwa über Dosieranlagen, laufend dokumentieren muss.
Verstöße gegen diese Vorgaben gelten entweder als Straftat (§ 71 TrinkwV) oder als Ordnungswidrigkeit (§ 72 TrinkwV). Die Formulierung in Satz 1 Nr. 2 von § 72 ist eindeutig: „Ordnungswidrig handelt, … wer … eine Anlage nicht richtig betreibt“.
Die Entnahme, der Transport und die Untersuchung der Wasserproben dürfen nur von zertifizierten Laboren durchgeführt werden. Eine Liste der in NRW zugelassenen Labore findet man hier: Liste zugelassener Labore.
Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, ein Labor zu beauftragen, das mit dem örtlichen Gesundheitsamt bereits Erfahrung hat. Eine gute Kommunikation zwischen Labor und Gesundheitsamt wird vor allem dann wichtig, wenn eine kritische Belastung festgestellt werden sollte.
Für die Einholung von Angeboten für die Trinkwasseruntersuchung ist es sinnvoll, den Laboren den Beprobungsplan der letzten Untersuchung vorzulegen. Es sind nicht alle Entnahmestellen zu beproben, sondern nur repräsentative Stellen im Leitungssystem. Falls kein Beprobungsplan vorliegt oder dieser nicht mehr aktuell ist, können die Entnahmestellen der Proben anhand von Plänen und in einem Ortstermin festgelegt werden. Eine gute Gebäudedokumentation ist hier sehr hilfreich.
Die Labore sind verpflichtet, kritische Befunde direkt dem Gesundheitsamt zu melden. Falls dieser Fall eintritt, sollte ein Sachverständiger für Trinkwasserhygiene eingeschaltet werden. Der Sachverständige wird in Abstimmung mit dem Labor und dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen festlegen. Falls diese Schritte nicht fristgerecht vom Betreiber veranlasst werden, kann das Gesundheitsamt im „worst case“ die Trinkwasseranlage sogar stilllegen.
Ist die Immobilie vermietet, gelten die Kosten für die Trinkwasseruntersuchung als Betriebskosten. Dann können sie auf die Mieter umgelegt werden. Nicht umlegbar sind jedoch Kosten für die Beseitigung einer festgestellten Kontamination oder für den Einbau von speziellen Ventilen zur Probenentnahme.
Bei Fragen zu diesem Thema oder bei der Umsetzung der Trinkwasserverordnung in Gebäuden helfe ich gerne weiter. Ich bin weder Sachverständiger für Trinkwasserhygiene noch Jurist und erteile keine Rechtsberatung. Als Asset Manager erkenne ich behördliche Auflagen und setze sie für den Immobilieneigentümer um.